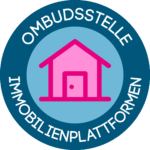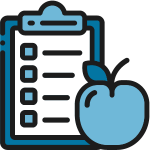Schweinerei im Naschregal
Wer liebt sie nicht, die bunten Gummibärli diverser Geschmackrichtungen (auf Nachfrage sind die roten am beliebtesten). Auch wenn sie ernährungsphysiologisch nicht gerade zu den wertvollsten Lebensmitteln zählen, ist ihre Beliebtheit ungebrochen. Diese schmelzende Süsse, dieser zarte Widerstand beim Kauen… und wie gut flutschen sie die Kehle hinab! Was der Gummibärliverzehrer gern verdrängt: die kleinen Teilchen bestehen aus viel, viel Zucker und unter anderem, immerhin bis zu 9%, aus Gelatine. Diese, ein allgegenwärtiger Bestandteil vieler Lebensmittel, stammt aus Schlachtabfällen: hauptsächlich aus Schweineschwarte.
Warum enthalten Gummibärchen Stoffe aus Schlachtabfällen?
Viele Gummibärchen enthalten Gelatine – dieses tierische Geliermittel verleiht Gummibärchen ihre charakteristische elastische und kaubare Konsistenz. Obgleich Gelatine traditionell aus Schlachtabfällen von Schweinen und Rindern gewonnen wird, wird sie noch immer eingesetzt, weil sie einzigartige Eigenschaften bietet, die für Textur und Mundgefühl dieser Süssigkeiten entscheidend sind.
Auch wenn führende Hersteller kontinuierlich auf pflanzliche Alternativen umstellen, in vielen Markenprodukten stecken daher noch immer Stoffe aus Schlachtabfällen – was im ersten Moment überrascht, denn wer erwartet Schweineschwartenextrakt in seinen Süssigkeiten?
Wie wird Gelatine hergestellt, und welche Rolle spielen Schlachtabfälle in diesem Prozess?
Gelatine stammt in der Regel aus Schlachtabfällen. Dabei handelt es sich um Teile von Tieren, die bei der Schlachtung anfallen und nicht für den direkten menschlichen Verzehr bestimmt sind. Gelatine ist also ein tierisches Eiweiss, das hauptsächlich aus Kollagen gewonnen wird, einem Protein, das in Bindegewebe, Knochen, Haut und Knorpel von Tieren vorkommt.
Die häufigsten Quellen für Gelatine sind Schweine, Rinder und manchmal auch Fische. Die Haut, Knochen und Sehnen von Schweinen sind die Hauptrohstoffe für Gelatine. Besonders häufig wird Schweineschwarte verwendet – daher ist vorwiegend Schweinegelatine in Lebensmitteln zu finden.
Zur Vorbehandlung des Rohmaterials werden Schweinehaut oder Rinderknochen gründlich gereinigt und in kleine Stücke zerkleinert. Die tierischen Teile werden dann unter anderem mit Salzsäure vorbehandelt (Säureextraktion). Anschliessend werden die kollagenhaltigen Schwarten & Co. erhitzt, um das Kollagen in Gelatine umzuwandeln. Durch einen speziellen Herstellungsprozess wird dieses Kollagen extrahiert und zu Gelatine verarbeitet. Am Ende wird die flüssige Gelatine gefiltert und geklärt – und kann als gereinigtes Endprodukt in der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden.
Gibt es gesundheitliche Bedenken im Zusammenhang mit dem Verzehr von Gelatine aus Schlachtabfällen?
Nein. Aus ethischer Sicht hingegen beschäftigt diese Frage heutzutage viele Menschen: «Warum müssen in meinem Gummibärchen Schweineschwartenreste drin sein? Will ich mit meinem Gummibärchen gleichzeitig Schlachtabfall-Stoffe mitessen?» Die Verwendung von Schlachtabfällen ist ein polarisierendes und umstrittenes Thema, das sowohl ethische als auch ökologische Aspekte berührt. Für Konsumenten, die nach Alternativen suchen, gibt es inzwischen aber eine Vielzahl von Lebensmitteln mit pflanzlichen Geliermitteln.
Gibt es Alternativen zu Gelatine aus Schlachtabfällen in Gummibärchen und anderen Lebensmitteln?
Ja, die gibt es. Für Menschen, die aus religiösen, gesundheitlichen oder ethischen Gründen keine Gelatine essen möchten, sind inzwischen viele tierfreie Produkte erhältlich. Diese Süssigkeiten enthalten statt Gelatine die pflanzlichen Geliermittel Agar-Agar, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl oder Pektin – auch wenn sie nicht die gleichen Eigenschaften bieten.
Daher sieht es derzeit so aus: obwohl einige bekannte Marken pflanzliche Alternativen verwenden («vegane Gummibärchen»), können diese Produkte oft eine etwas andere Textur und Konsistenz haben, die nicht allen munden. Daher heisst die Devise: probieren, was einem am besten schmeckt! Hören Sie dabei auf Ihre persönliche Ethik und Intuition.
Uwe Knop
Ernährungswissenschaftler